BraunschweigerBörsenBRIEF – Ausgabe 12
An den weltweiten Aktienmärkten herrscht trotz Zuspitzung des Zollkonflikts zwischen USA/Europa und USA/China weiterhin Partystimmung. Doch inwieweit ist diese fast schon fahrlässig anmutende Unbekümmertheit der Marktteilnehmer berechtigt?
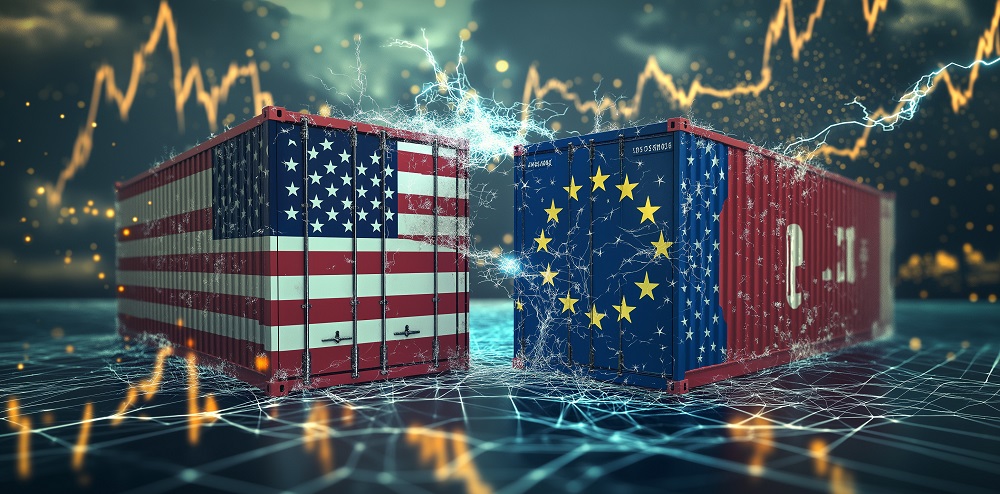
Eine Reihe volkswirtschaftlicher Daten der letzten Woche bringt etwas Licht ins Dunkel
Die Aktienmärkte präsentierten sich in der vergangenen Woche wieder von ihrer unbekümmerten, fast euphorischen Seite. Anders lässt sich nicht erklären, weshalb Aktienindizes weltweit in der Nähe ihrer Höchststände notieren. Denn eigentlich geben die ökonomischen und politischen Rahmendaten aktuell wenig Anlass, um in Kaufeuphorie zu verfallen. Doch mit den Aktienmärkten verhält es sich zurzeit ein wenig wie mit der „Die-Frisur-hält-immer“-Versprechung bei der „Drei-Wetter-Taft“- Werbung der 80er Jahre. Egal, ob in Washington der US-Präsident wieder die Zollkeule schwingt und dreißigprozentige Strafzölle ab dem 1. August androhti, ob in Berlin neue Ausgaben von über 600 Mrd. Euro (eigene Berechnung bezüglich Kernhaushalt, Sondervermögen und Sonderpositionen für 2025) ohne wirklich nachhaltige Gegenfinanzierung geplant werden (geplante Einnahmen des Bundes von 503 Mrd. Euro für 2025)ii oder ob Moskau Europa und Deutschland mit atomaren Konsequenzen droht, sollten – wie vom Bundeskanzler Friedrich Merz jüngst angekündigtiii – weitreichende Waffensysteme an die Ukraine geliefert werdeniv. Dies alles ficht den Aktienmarkt so gar nicht an, die Aktienkurse steigen immer weiter.
Während vielleicht die Sorglosigkeit der US-Anleger, vor allem was die militärische Bedrohungsgefahr und damit die Gefahr einer militärischen Eskalation und Ausweitung des Russland-Ukraine-Krieges angeht, ob der geographischen Ferne gerade noch nachvollziehbar ist, bleibt die Unbekümmertheit der Anleger in Europa und in Deutschland doch sehr erstaunlich. Erst Anfang der Woche meldete der hiesige Militärische Abschirmdienst (MAD), dass Russland so stark und massiv in Sabotageaktionen gegen die Bundesrepublik verwickelt ist wie seit Zeiten des Kalten Krieges nicht mehrv.
Anlegen in Zeiten globaler Spannungen – Die Lehren aus den Zeiten des Kalten Krieges
Apropos Kalter Krieg: Die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion sowie den USA und China erfuhren in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch die hegemonialgetriebene Außenpolitik der US-Präsidenten Kennedy, Johnson und Nixon in Form von Stellvertreterkriegen in Südostasien und Mittelamerika (z. B. Vietnamkrieg, Koreakrieg, Kambodscha-Krieg, Kubakrise) ihren Höhepunkt. Zwar änderten die USA schon zu Zeiten Nixons, nach dem gescheiterten und verheerenden Militäreinsatz in Vietnam, ihre offensive Außenpolitik in Richtung einer defensiv anmutenden globalen Ordnungsmacht im Hintergrund, doch die wirkliche Entspannungspolitik setzte erst 1975 mit der Schlussakte von Helsinki (KSZE) ein, welche letztendlich den Grundstein der weiteren Annäherung zwischen den Weltmächten USA und Sowjetunion einläutete und den Weg für ein friedlicheres Miteinander in Zeiten des Kalten Krieges frei machte.
Doch die in dieser Ära der politischen Eiszeit vor sich hin dümpelnden globalen Aktienbörsen sollten noch lange Zeit nicht von der neuen Entspannungspolitik profitieren können. So war der US-Aktienindex Dow Jones seit dem Oktoberhoch von 1965 bis November 1982 über 17 Jahre in einem zähen und weiten Seitwärtstrend gefangen. Der Ausbruch aus diesem Trend und die Fortsetzung der Börsenhausse, welche ihren Anfang nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Ende 1945 hatte, gelang dann aber schließlich durch die zunehmende Globalisierung der westlichen Industrieunternehmen in Billiglohnländern und der damit verbundenen massiven Effizienzsteigerung der globalen Großkonzerne ab Mitte der 1970er Jahre. Diese weltwirtschaftliche Integration wäre ohne die stabilere politische Weltordnung nicht möglich gewesen.
Donald Trump, die Deglobalisierung und der Kalte Krieg 2.0
Seit dem erneuten Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump im Januar dieses Jahres, scheint sich die bewährte wirtschaftspolitische Integration der Weltwirtschaft im Zeitraffer zurückzuentwickeln. Denn die vom US-Präsidenten verhängten Strafzölle gegen die gesamte Welt sind nicht nur ein großer Bremsklotz der freien globalen Marktwirtschaft. Auch reduzieren hohe Zölle die Profitabilität von global agierenden Unternehmen, was sich nicht nur negativ auf das globale Wirtschaftswachstum auswirken wird, sondern natürlich auch inflationstreibend ist. Denn zum einen führen höhere Zölle zu höheren Preisen für Endverbraucher, wie die Konjunkturumfrage „Beige Book“ der US-Notenbank in der vergangenen Woche bestätigtevi. Zum anderen würde die zollgetriebene Ansiedlung von arbeitsintensiven Industrien aus Niedriglohnländern in hochentwickelten Volkswirtschaften, wie sie von Donald Trump erzwungen bzw. besser gesagt, erpresst wird, zu deutlich höheren Produktionskosten führen (laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln sind die industriellen Arbeitskosten in den USA etwa fünfeinhalb Mal höher als in China)vii, was wiederum die Produktpreise und damit eben auch Verbraucherpreise massiv ansteigen ließe. Die direkte Konsequenz hieraus wäre, dass der desinflationäre Trend des Zeitalters der Globalisierung ab 1975 bis 2020 abgebremst bzw. in Teilbereichen auch ins Gegenteil gekehrt werden würde.
Hohe US-Verbraucherpreise im Angesicht steigender Zölle und sinkender Energiepreise
Hinsichtlich der Verbraucherpreise liefern die in der letzten Woche veröffentlichten US-Daten ebenfalls neue Erkenntnisse. So sind die Preise für Waren und Dienstleistungen in den USA auf Jahresbasis um 2,7 Prozent angestiegen. Damit liegen diese nicht nur weiterhin über der Zielmarke (2,0 Prozent) der US-Notenbank (Fed), sondern in Anbetracht der seit Monaten sinkenden und damit desinflationär wirkenden Energiepreise auch generell auf einem zu hohen Niveau. Ein Preistreiber des jüngsten Anstiegs der Verbraucherpreise waren die sprunghaft angestiegenen Preise für Importwaren (Möbel, Konsumgeräte, Kleidung etc.). Hier sind die Preise aufgrund der Strafzölle deutlich stärker angestiegen, als bei normalen Preisschwankungen zu erwarten wäre. Dabei ist die volle Wucht der Preissteigerungen noch nicht einmal bei den Konsumenten angekommen, scheuen sich doch viele Unternehmen aufgrund des harten Wettbewerbs im Einzelhandel, die gestiegenen Einfuhrkosten an die Konsumenten weiterzugeben. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die Verbraucherpreise in den nächsten Monaten kontinuierlich ansteigen werden.
Von der Trump-Administration ist in dieser Hinsicht kaum mit einem Einlenken zu rechnen. Denn unserer Ansicht nach rechnet die US-Regierung bereits fest mit den Einnahmen aus den neuen Zöllen. Diese hat sie auch bitter nötig. Denn der US-Staat ist bereits jetzt mit über 120 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP) unhaltbar hoch verschuldet. Allein das zuletzt durch den US-Kongress verabschiedete kostspielige und umstrittene „Big Beautiful Bill“-Steuerentlastungs-, Sozialabbau- und Investitionspaket wird, unseren Berechnungen nach, die jährliche Staatsverschuldung um 289 Mrd. Dollar, also um knapp 1 Prozent, erhöhen. Diese massive Erhöhung der Schulden wird die Trump-Regierung sehr wahrscheinlich durch die bereits erfolgte Erhöhung der Basiszölle von zuvor 2,5 Prozent auf aktuell 10 Prozent gegenfinanzieren wollen. Unseren Berechnungen nach werden der US-Regierung nur durch die neuen Basiszölle 308 Mrd. US-Dollar jährlich zufließen, wodurch das „Big Beautiful Bill“ gegenfinanziert wäre.
Robuster US-Einzelhandel mit zollbedingten Schönheitsfehlern
Der Effekt der US-Zölle ließ sich letzte Woche ebenfalls in den veröffentlichten US-Einzelhandelsdaten nachvollziehen. Zwar zeigten die Daten, dass die US-Verbraucher trotz der Unsicherheiten rund um die Zollpolitik des US-Präsidenten im Mai nominal 0,6 Prozent mehr konsumierten als im Vormonat (damals war der Konsum nominal um 0,9 Prozent zurückgegangen). Allerdings sind die Einzelhandelsdaten stark durch die „On-Off-Zollpolitik“ der Trump-Administration geprägt. Dies bedeutet, dass die guten Konsumzahlen womöglich teilweise auch auf vorgezogene Käufe, in Erwartung weiterer Zölle, zurückzuführen sind. Dies ist u. a. daran zu erkennen, dass viele Konsumkategorien mit hohen zollbedingten Preisaufschlägen Verkaufsrückgänge zeigten, wohingegen der Konsum von Artikeln und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs stärker nachgefragt wurde. Dieses veränderte Konsumverhalten, sollte es aufgrund hoher Zölle weiter anhalten, würde auf mittlere Sicht zu einer Schwächung der privaten Nachfrage und damit insgesamt zu einer Schwächung des amerikanischen Wirtschaftswachstums führen.
Robuste chinesische Wachstumsstatistiken erzählen zollbedingt nur die halbe Wahrheit
Interessant waren in der letzten Woche auch neue Wirtschaftsstatistiken aus China, die nun immer mehr die Auswirkungen des Zollstreits mit den USA verdeutlichen. So wächst die Wirtschaft in China gemessen am BIP zwar mit 5,2 Prozent gegenüber 2024 noch sehr deutlich. Doch das dynamische Wachstum ist vor allem Sondereffekten und staatlichen Maßnahmen geschuldet. So stiegen die chinesischen Exporte auf Jahresbasis zwar um stolze 5,8 Prozent an. Doch lag dies vor allem daran, dass viele chinesische Exporteure noch vor Ende der neunzigtägigen US-Zollverhandlungsfrist, welche am 12. August endet, ihre Auslandsverkäufe vorgezogen hatten.
Zudem ist ein Großteil des Wirtschaftswachstums das Ergebnis massiver staatlicher Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung und Stärkung des außerordentlich schwachen inländischen Konsums, welcher nach wie vor unter den Nachwehen der Corona-Pandemie sowie des Platzens der Wohnimmobilienblase im Jahr 2021 leidet. Unseren Berechnungen nach sind etwa 1,2 Prozent des aktuellen jährlichen BIP-Wachstums direkt auf staatliche Fördermaßnahmen zurückzuführen, was das jährliche organische Wirtschaftswachstum auf 4,0 Prozent reduziert. Für China, das sich weiterhin in einer gesamtwirtschaftlichen Take-off-Phase befindet und somit ein hohes BIP-Wachstum benötigt, um das sozioökonomische Niveau des gesamten Landes weiter zu heben, ist dies ein unzureichendes Wachstum.
Für die globale Wirtschaftsentwicklung ist ein schwacher chinesischer Konsument ebenfalls nachteilig. So substituieren kostenbewusste chinesische Konsumenten immer mehr westliche Produkte durch heimische Produkte, die nicht nur qualitativ hochwertig und gleichzeitig deutlich günstiger sind, sondern auch den Geschmack der einheimischen Bevölkerung zumeist besser treffen. Deutsche Luxusautobauer wie Porsche, Mercedes und BWM leiden so schon seit einiger Zeit unter einbrechenden Absätzen im Reich der Mitte. Ähnlich ergeht es auch anderen Luxusgüterkonzernen wie LVMH, Richemont oder Kering. Insgesamt ist daher von chinesischer Seite in den nächsten Quartalen mit geringer wirtschaftlicher Unterstützung für die Weltwirtschaft zu rechnen. Im Gegenteil: Sollte sich der chinesische Zollkrieg mit den USA weiter verschärfen, bestünde große Gefahr, dass die Chinesen versuchen werden, verloren gegangene Absatzmärkte in den USA mit europäischen zu ersetzen, was das produzierende Gewerbe in Europa wiederum unter Druck setzen könnte.
Robuste Industrieproduktion im Euroraum dank Zöllen und sich lösendem Investitionsstau
Interessant waren auch neue Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Der Anstieg von 3,7 Prozent auf Jahressicht lässt hoffen, dass das Tal der Tränen bald durchschritten sein könnte. Zwar sind die Zahlen durch zollbedingt vorgezogene Produktion (vor allem im Bereich der Pharmaindustrie) verzerrt. Doch auf der anderen Seite zeichnet sich mittlerweile in Europa der positive Trend ab, dass Kapitalgüter, welche die Basis der industriellen Produktionskette darstellen, wieder vermehrt nachgefragt werden. Da sich dieser Trend seit Monaten stetig verfestigt, kann aufgrund des aktuellen konjunkturellen Zyklus davon ausgegangen werden, dass das produzierende Gewerbe nach langer Zeit der Stagnation in den kommenden Quartalen wieder auf Wachstum umschalten wird. Aktuell jedoch weist der Produktionsrückgang bei Vorprodukten und Gebrauchsgütern noch auf eine schwache industrielle Nachfrage hin. Wir gehen davon aus, dass die jetzige schwache Nachfrage zum Großteil auch der Zollunsicherheiten geschuldet ist.
In der Eurozone steigen die Verbraucherpreise wieder leicht an. Die Europäische Zentralbank wird dabei mit weiteren Zinssenkungen keine besondere Eile haben
Eine der wichtigsten Wirtschaftsstatistiken der letzten Woche waren die Inflationsdaten aus der Eurozone. Hier ist die Jahresrate der Verbraucherpreise wieder etwas angestiegen und liegt nun bei 2,0 Prozent nach 1,9 Prozent im Vormonat. Damit liegt die Inflationsrate genau auf der Zielgeraden der EZB (2,0 Prozent). Ursächlich für den leichten Anstieg waren die wieder etwas stärker angestiegenen Dienstleistungspreise (vor allem Restaurants, Hotels, Versicherungen und Gesundheit) und Lebensmittelpreise. Unsere ökonometrischen Modelle zeigen, dass sich die Inflationsrate indes in den nächsten Monaten wieder etwas deutlicher nach oben bewegen könnte. Dies vor allem, weil davon auszugehen ist, dass die aktuell desinflationär wirkenden Energiepreise wieder deutlicher anziehen könnten, so dass das gesamte Verbraucherpreisniveau wieder spürbar höher wäre. Zudem zeigen unsere Modelle, dass einerseits die Industriegüterpreise aufgrund höherer Nachfrage wieder deutlicher zulegen werden, andererseits aber der Preisdruck aufgrund weiter steigender Löhne und Gehälter von der Dienstleistungsseite auf absehbare Zeit hoch bleiben wird. Dies alles wird dazu führen, dass sich die Inflationsrate in der Eurozone wieder in den Bereich von 2,5 Prozent bewegen könnte.
Für die Europäische Zentralbank (EZB), die diese Woche wieder zur Zinsentscheidung tagt, bedeutet dies, dass nach den acht Zinssenkungen seit Mitte 2024, die zu einem Rückgang des Einlagensatzes der EZB von 4,0 Prozent auf 2,0 Prozent geführt haben, am kommenden Donnerstag erst einmal Pausieren angesagt sein sollte. Dies aus unserer Sicht vor allem deswegen, weil nach aktuellem Datenstand die Inflations- und Desinflationsrisiken derart ausgewogen sind, dass eine Feinjustierung der Notenbankzinsen nach unten nicht notwendig erscheint. Auf der anderen Seite liegt unseren Berechnungen nach der nominale neutrale Notenbankzins r* (also der Zins, der weder inflationär noch deflationär wirkt) etwas tiefer bei 1,5 Prozent bis maximal 2,0 Prozent (realer neutraler Zins: -0,5 Prozent bis maximal 0,0 Prozent), so dass eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozent bei einem der nächsten Zinsentscheidungstermine wahrscheinlich erscheint.
Unser Fazit
Die jüngsten Konjunkturdaten weisen auf eine sich global weiter abkühlende Wirtschaft hin. Dabei verzerren die starken Unsicherheiten im Zusammenhang mit den US-Zöllen zwar weiterhin das Gesamtbild sehr stark, insgesamt lässt sich aber für die Eurozone eine Stabilisierung der Wirtschaft ableiten. Hierbei ist zu erwarten, dass der Inflationsdruck wieder etwas deutlicher zunehmen wird.
Die amerikanische Wirtschaft verliert zwar weiter an Tempo, doch ist trotz des aggressiven Zollkrieges der Trump-Administration noch keine nachhaltige Schwächung der US-Wirtschaft zu erkennen. Dies liegt unserer Ansicht nach zum Großteil daran, dass die negativen Effekte des Handelskrieges aktuell noch von vorgezogenen, äußerst dynamischen wirtschaftlichen Aktivitäten der Industrie und der Konsumenten stark überlagert werden. Doch dieser „positive“ Effekt wird nicht von langer Dauer sein. Sollte es den Amerikanern gelingen, gegen die Chinesen und die Europäer hohe Zölle durchzusetzen, um dafür dann entsprechende Gegenzölle in Kauf nehmen zu müssen, würde dies zu einer nachhaltigen Schwächung des Wirtschaftswachstums in allen drei Wirtschaftsregionen führen. Aus der heutigen Perspektive kann vielleicht das „Worst-Case-Szenario“ verhindert werden, doch die US-Zölle werden sehr wahrscheinlich kommen und sie werden so hoch sein, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen deutlich spürbar werden.
Für die Aktienbörsen, die weltweit immer noch in Partystimmung verharren, könnte dies ein böses Erwachen bedeuten. Denn die hohen Kurse und die hohen Bewertungen der Aktienmärkte spiegeln keinesfalls die wirtschaftlichen, geschweige denn die latenten geopolitischen Risiken in Europa, dem Nahen Osten und im Südchinesischen Meer wider.
Wir errechnen für das kommende Jahr ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den Dax von 17,5. Dieses liegt deutlich über dem langfristigen Schnitt von 13. Würde man nur das KGV als Basis für den fairen Wert des Dax verwenden, läge dieser bei 17.800 Punkten und damit weit unter dem aktuellen Stand von 24.000 Punkten. Analysiert man den fairen Wert des Dax aus Sicht der relativen Risikoprämie, die ein Anleger erhalten muss, wenn dieser, anstatt in sicheren zehnjährigen Bundesanleihen zu investieren, in den Dax investiert, so sind Aktien ebenso überbewertet. Denn unsere langfristigen Analysen zeigen, dass die mittlere stabile Risikoprämie des Dax gegenüber zehnjährigen Bundesanleihen mindestens 4,5 Prozent ausmachen sollte, was aktuell einem fairen Dax von maximal 19.000 Punkten entsprechen würde.
Betrachtet man die oben genannten wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken, aber auch die Tatsache, dass die US-Börsen auf Basis des von uns erwarteten KGVs (für 2026) von 24 (S&P 500) noch höhere Überbewertungen anzeigen und damit ebenfalls auf korrekturgefährdeten Höhen notieren, scheint die aktuelle Überbewertung des Dax nicht haltbar zu sein, so dass weiterhin eine defensive Anlagestrategie richtig erscheint.
Für die deutschen Anleihemärkte könnten die geopolitischen und wirtschaftlichen Risiken zu stabilen bis leicht sinkenden Zinsen am längeren Ende der Laufzeitenkurve führen. Das kürzere Ende der Zinsstrukturkurve wird sich aufgrund des zu erwartenden baldigen Endes des Zinssenkungszyklus der EZB weniger nach unten bewegen, so dass die gesamte Zinskurve wieder etwas abflachen sollte. Dies gilt freilich nur, solange der Zollstreit der EU mit den USA nicht eskaliert. Denn in einem solchen Fall würde die EZB wahrscheinlich zu einem Notprogramm greifen müssen, was deutlich sinkende Zinsen zur Folge haben könnte, was die Zinskurve wieder steiler werden ließe.
Es gibt aber auch noch ein weiteres Szenario für den Anleihemarkt: Sollte es dem US-Präsidenten Trump gelingen, den aktuellen Chef der US-Notenbank Powell aufgrund eines politischen Coups (z. B. Betrugsvorwurf wegen des Umbaus der Fed-Zentrale in Washingtonviii) durch einen ihm treuen Kandidaten zu ersetzen, hätte dies massive Folgen für die Zinsentwicklung in den USA, aber auch in Europa. Denn Donald Trump fordert schon lange, dass die US-Leitzinsen (Federal Funds Rate) von aktuell 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent auf 1 Prozent sinken müssen. Dass der US-Notenbankchef dem Willen Donald Trumps nicht folgt, macht den Präsidenten nicht nur wütend, sondern auch angriffslustig:
„Jerome Powell ist ein Dummkopf, der keine Ahnung hat“ix
Damit überschreitet der US-Präsident erneut nicht nur jegliche rote Linie des Anstandes, sondern auch die der staatlichen Einflussnahme auf ein eigentlich regierungsunabhängiges Institut. Sollte letztere Realität werden, womit die Unabhängigkeit der US-Notenbank in Frage gestellt wäre, dann hätte dies extrem negative, gar zerstörerische Auswirkungen auf den Finanzplatz Amerika und dessen Finanzinstrumente.
Dass die US-Notenbank die Zinsen nicht senkt, hat aber einen guten Grund: Die Trump-Administration und ihre inflationäre Wirtschaftspolitik (massive Zölle und ausufernde Staatsausgaben). Würde Fed-Chef Powell ersetzt werden, so dass die Zinsen dann schrittweise in Richtung 1 Prozent gesenkt würden, hätte dies zur Folge, dass die Finanzmärkte annehmen würden, dass die Fed-Politik die Inflation stark begünstigen würde, so dass deutlich höhere zukünftige Inflationsraten am langen Ende der Zinskurve, also bei längerfristig laufenden Anleihen, eingepreist werden müssten. So könnte dies z. B. zu einem sprunghaften und sehr deutlichen Anstieg der zehnjährigen US-Staatsanleihe von deutlich über 5 Prozent führen. Die US-Zinsstrukturkurve würde dann deutlich steiler werden.
Herzlichst Ihr
Dr. Reza Darius Montassér, CMT
Chefökonom Braunschweiger Privatbank
- www.reuters.com/business/autos-transportation/eu-ramp-up-retaliation-plans-us-tariff-deal-prospects-dim-2025-07-21/
- www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2025/06/2025-06-24-2-entwurf-bhh-2025-eckwerte-bis-2029.html
- www.politico.eu/article/germany-merz-lifts-range-limits-ukraine-weapons-russia-taurus-missiles/
- www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukraine-krieg-kreml-peskow-atomwaffen-putin-trump-100.html
- www.zeit.de/digital/internet/2025-07/militaerischer-abschirmdienst-russland-spionage-geheimdienste
- www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beigebook202507-summary.htm
- www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2016/296545/IW-Trends_2016-03-03_industrielle_Arbeitskosten.pdf
- https://www.spiegel.de/wirtschaft/donald-trump-vs-fed-chef-jerome-powell-rufmoerder-im-dienste-des-praesidenten-a-c49a7a49-4b0c-4194-94e8-415a1b88aa63
- www.zeit.de/news/2025-05/08/trump-beschimpft-fed-chef-nach-entscheidung-als-dummkopf
